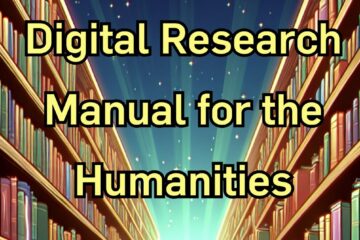Du willst Medienluft schnuppern, erste journalistische Erfahrungen sammeln und Teil eines kreativen, engagierten Teams werden? Dann ist das Praktikum bei CT das radio genau das Richtige für dich!
CT das radio ist das Campusradio aller Bochumer Hochschulen und bietet jedem Semester bis zu 20 Studierenden die Möglichkeit, ein praxisnahes Radiopraktikum zu absolvieren. Ziel ist es, dir die Grundlagen des journalistischen Arbeitens im Hörfunkbereich zu vermitteln – egal, welches Studienfach du hast.
Darauf kannst du dich freuen:
- Praxisnahes Arbeiten: Recherche, Interviews, Schnitt, Beitragsgestaltung und Moderation – alles aus erster Hand.
- Social Media & Multimedialität: Eigenständige Umsetzung von Beiträgen für Instagram und weitere Plattformen.
- Flexible, semesterbegleitende Arbeitszeiten: Ein fester Arbeitstag während der Vorlesungszeit, freundliche Arbeitsatmosphäre und Weiterbildungsmöglichkeiten inklusive.
- Vielfältige Ressorts: Von Kultur über Musik bis Kino – finde dein Themengebiet und vertiefe dein Wissen.
- Langfristige Perspektive: Nach dem Praktikum kannst du dich weiterhin ehrenamtlich bei CT das radio engagieren.
Rahmenbedingungen:
- Anerkennung als 10 CP Praktikum im Optionalbereich möglich
- Semesterbegleitend, insgesamt ca. 240 Stunden inkl. Praktikumsbericht
- Offene Bewerbung jederzeit; Beginn immer in der ersten Woche der Vorlesungszeit
Voraussetzungen:
- Studierende aller Bochumer Hochschulen, egal welches Fach
- Keine journalistischen Vorkenntnisse nötig
- Motivation, Eigenständigkeit, Zuverlässigkeit und Teamfähigkeit
Interessiert?
Dann sende einfach eine kurze Nachricht an mitmachen@ctdasradio.de, in der du erklärst, warum du Teil von CT das radio werden möchtest. Weitere Infos findest du auf der Website: www.ctdasradio.de
Mach den ersten Schritt in die Welt des Radios – dein Mikrofon wartet schon!